Mensch vs. Maschine: Ersetzt das Hawk-Eye die Linienrichter?
Seit 15 Jahren sorgt ein elektronisches Auge für mehr Fairness im Profitennis. Bei Sandplatz-Turnieren wird allerdings noch gänzlich auf Linienrichter vertraut, in Roland Garros will man sich explizit den menschlichen Faktor bewahren. Doch der Ruf nach Veränderung wird nicht nur in Paris lauter. Denn die Pandemie beschleunigt die Tendenz, nur mehr Maschinen entscheiden zu lassen.
Corona forciert elektronisches Auge
Groß war vor einem Jahr die Freude in der Szene, als die Tennisprofis nach monatelangem Stillstand wieder zu ihren Schlägern greifen und sich bei Exhibitions und Einladungsturnieren messen durften. Den Sicherheitskonzepten in der Pandemie geschuldet, fanden diese Matches fast ausschließlich vor leeren Rängen statt, teilweise mussten die Spieler sogar selbst die Bälle aufheben und den Platz abziehen, um die Anzahl an Personen auf der Anlage auf ein Minimum zu reduzieren.
![]()
![]()
Electronic Line Calling bei US Open Series
Vor allem wegen der Genauigkeit der Ballaufsprünge stehen fast alle aktiven Profis der technischen Modernisierung grundsätzlich positiv gegenüber, selbst Roger Federer hat seine anfängliche Skepsis längst abgelegt. Doch nun will man einen Schritt weitergehen. „Bei allem Respekt für die Tradition und Kultur unseres Sports sehe ich keinen Grund, warum nicht alle Turniere in der Welt ein System nutzen, wie wir es vor den US Open verwendet haben", outet sich Novak Djoković als Verfechter einer kompletten Umstellung auf das Hawk-Eye.
– Novak Djoković


Djokovic tritt für die Linientechnik ein – nicht ganz uneigennützig.
In dieser Saison ziehen alle großen Turniere der neun Stationen umfassenden US Open Series nach. Zusätzlich zum finalen Major des Jahres wird bei sechs weiteren Veranstaltungen im Vorfeld des New Yorker Spätsommer-Highlights das „Electronic Line Calling" zur Anwendung kommen. Auch das in den Oktober verschobene Masters-Event von Indian Wells setzt erstmals auf eine digitale Lösung.
Kosten für kleine Veranstalter kaum zu stemmen
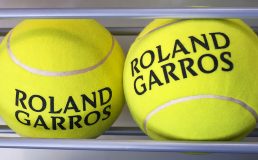
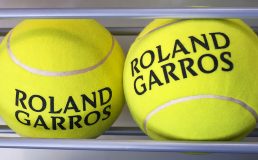
Kommen vorläufig ohne Hawk Eye-Technik aus: Die French Open.
Erstmals kam das Hawk-Eye 2006 bei den US Open zum Einsatz, längst lassen sich auch bei den Australian Open, in Wimbledon und weiteren großen Turnieren Rufe der Linienrichter durch eine Maschine überprüfen. Noch wird bei diesen Events nur bei knappen Entscheidungen die Technik herangezogen, bei den French Open fehlt sie völlig. Doch wird auch in Roland Garros der Wunsch nach dem elektronischen Auge immer lauter, obwohl der Ball auf Sand einen deutlichen Abdruck hinterlässt.
French Open bleiben traditionell


Dominic Thiem (hier bei den Barcelona Open) hat selbst schon mal von einer falschen Schiri-Entscheidung profitiert.
Der französische Tennisverband FFT erteilt der Forderung aber eine klare Absage, wie er in einer Presseaussendung im Zuge der letztjährigen Diskussionen rund um das Thema festhielt:
Unterstützung erhalten die Offiziellen von Garbiñe Muguruza, die zu den wenigen Befürwortern des Augenmaßes zählt. „Wenn wir nur noch Maschinen auf dem Platz haben, wird es für uns noch einsamer", meint die Paris-Siegerin von 2016. „Mir gefällt es besser, wenn jemand ,in' oder ,out' ruft."
– Garbiñe Muguruza


Maschine als Emotionskiller
Wie Muguruza positioniert sich auch Ben Rothenberg als erklärter Gegner eines reinen Hawk-Eye-Systems ohne Linienrichter. Der ebenso renommierte wie streitbare Tennis-Journalist der New York Times befürchtet ein Ende lebhafter Diskussionen zwischen Spielern und Schiedsrichtern, das dem Sport einen Teil seiner Seele berauben würde, wie er meint, und verweist dabei auf John McEnroes berüchtigte Ausraster:
Rothenberg sei bewusst, dass der Verzicht auf Linienrichter den Spielern eine große Last von der Schlaghand nehmen würde. „Für die Fans wäre es aber schlecht. Sie wollen sehen, wie der Spieler mit Druck umgeht, wie er leidet und wie er gelegentlich die Nerven verliert."
Diskussionen im Fußball Grund für Popularität
Ähnlich argumentiert Mats Wilander, der Emotionen als Essenz des Sports bezeichnet, wie er in einem Gastbeitrag in der französischen L'Équipe ausführt:
Der siebenmalige Major-Gewinner glaubt, dass eine Maschine nie derartige Emotionen in John McEnore hätte auslösen können, den seiner Ansicht nach beliebtesten Tennisspieler aller Zeiten. „Wäre er trotzdem so hoch aufgestiegen? Ich bezweifle es."
